Pathologie vor dem Wandel
Labor 4.0Pathologe vom Aussterben bedrohtEin schwieriger Beruf im Wandel
Die Verantwortung ist hoch, gleichzeitig erschweren veraltete Vorschriften den Arbeitsalltag. Viele Pathologen stehen kurz vor dem Rentenalter und der Mangel an Nachfolgern macht sich immer stärker bemerkbar.
Digitalisierung und KI könnten einige der Probleme lösen.
Krebsdiagnose per MaschineKünstliche Intelligenz gewinnt an Bedeutung
Dabei weden die digitalen Möglichkeiten immer besser. Auch zeigen verschiedene Studien: intelligente Algorithmen erkennen Krebszellen schneller und treffsicherer als manch ein Pathologe.
(Beispielstudie:. "Terabyte-scale Deep Multiple Instance Learningfor Classification and Localization in Pathology")
Im Bild Automatisierung bei Prodermpath.
Prof. Klaus GriewankKI wird kommen"Was passiert, wenn es Leute wie uns nicht mehr gibt?"
Doch was passiert, wenn KI versagt und es Leute wie ihn nicht mehr gibt, fragt er sich.
Neue WegeInhalt
Pathologen unter Bedrängnis
Hohes DurchschnittsalterFakten & Zahlen zur Branche

Voraussichtlich werden also etwa 800 Pathologen über die nächsten 10 Jahre verteilt aufhören zu arbeiten - im Jahr stehen also 80 ausscheidende Pathologen gegenüber rund 60 bis 70 Nachrückern (Laut Pathologenverband ist dies die jährlich Anzahl der FA-Anerkennungen).
Eine gleichbleibende Anzahl von ÄrztInnen bedeutet aber nicht eine gleichbleibende Versorgungszahl. Laut Bundesverband der Pathologen werden für einen ausscheidenden Pathologen/in 1,5 NachrückerInnen benötigt.
Es werden also dringend Wege gesucht, dem drohenden Mangel zu begegnen.
Aktuelle Lage ... denn ohne pathologischen Befund, keine Krebstherapie Gebührenordnung und Zulassungsbeschränkungen bremsen
Aktuelle Lage ... denn ohne pathologischen Befund, keine Krebstherapie Gebührenordnung und Zulassungsbeschränkungen bremsen

Krebsdiagnose
Die Anzahl der Pathologen wächst seit etwa 10 Jahren nur noch geringfügig. Die Anzahl der Diagnose-Aufgaben wächst hingegen rasant. Eine präzise und schnelle Diagnostik spielt bei Krebserkrankungen oft eine lebensentscheidende Rolle. Der Trend zur personalisierten Medizin beschert den Pathologen zusätzlich zu den bestehenden morphologischen Aufgaben, weitere Untersuchungen und ein Plus an Laborarbeit
Veraltete Gebührenordnung
In einem pathologischen Labor präparieren Laboranten/Innen Gewebe, das in Arztpraxen oder Krankenhäusern dem Patienten entnommen wurde. Anschließend 'befundet' der Pathologe es, indem er die Zellstrukturen unter dem Mikroskop auf krankhafte Veränderungen hin untersucht. Für die Kassenärztlichen Vereinigung gehören beide Leistungen zusammen und können nur gemeinsam abgerechnet werden. "Der EBM - Einheitlicher Bewertungsmaßstab - regelt detailliert, was zu einer sogenannten 'verpflichtenden vollständigen Leistungserbringung' gehört und wie es vergütet wird", erläutert Dr. Roland Stahl, Pressesprecher der KBV. Das erschwert die Zusammenarbeit mit anderen Patholgie-Laboren und bremst die Digitalisierung. Niedergelassene Ärzte versuchen oft jahrelang ohne Ausfalltage auszukommen.
Abrechnen kann der Arzt außerdem nur, wenn die Leistung an dem Ort seines Kassensitzes erbracht wurde - das schränkt die Nutzung digitaler Methoden weiter ein.
Berufsrecht versus Kassenrecht
"Es besteht für Ärzte in Deutschland Methodenfreiheit in Diagnostik und Therapie", sagt Prof. Gunter Haroske vom Bundesverband Deutscher Pathologen. Doch nicht alle Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) akzeptieren dies. " In der Radiologie kann digital befundet werden, weil die Teleradiologie in der Strahlenschutzverordnung geregelt ist. Für die Pathologie gibt es kein entsprechendes Gesetz", heißt es seitens der Bundes KV.
Zulassungsbeschränkung
Seit den 90er Jahren gibt es eine Zulassungsbeschränkung für Pathologen, wie auch für andere Kassenärzte. Aktuell wird in einer Bedarfsplanungsreform dieser Verteilungsschlüssel erstmals angepasst. Ob das zu einer Entspannung der Versorgungssituation ländlicher Gebiete führt, wird sich zeigen.
Bundesverband Deutscher Pathologen Digitalisierung ist notwendig Prof Gunter Haroske
Bundesverband Deutscher Pathologen Digitalisierung ist notwendig Prof Gunter Haroske

Hohes Einsparpotenzial
Eine Einführung digitaler Workflows, einschließlich der Digitalen Mikroskopie bedeutet einen großen Einschnitt. "Je nach Stand des Labors müssen sie größere Umstellungen in Ausstattung und Pflege des gesamten Workflows vornehmen", so Haroske.
Doch das Einsparpotenzial für Pathologen ist hoch. Das hat der Bundesverband bereits eruiert: "Wir haben Daten aus mehreren Pathologie-Praxen und kamen auf Einsparpotenziale in Höhe von 15 bis 20 Prozent." Trotzdem verläuft die Einführung holperig. "Es gibt zu viele Insellösungen", sagt Haroske. Jedes Krankenhaus mache, was es wolle. Erst mit einer auf Standardisierung beruhenden Interoperabilität profitieren Pathologe und Patient umfassend von der Digitalisierung. Dafür engagiert sich Haroske im Bundesverband. "Der Startschuss in der Politik ist gefallen", sagt Haroske und zählt Initiativen wie das eHealth Gesetz und das Digitale Versorgungsgesetz auf.
Für Praxen, die ihr System umstellen wollen, hat der Pathologenverband Leitfäden für die Validierung von Digitalmikroskop und Scanner sowie für den Digitalen Workflow entwickelt.
Aus der Praxis
Klaus Griewank und Ana-Maria Gebing erzählenEin sehr spezieller BerufsalltagBegeisterung für einen schwierigen Beruf
Dr. Ana-Maria Gebing: "Das zu sehen, was sich unter der Haut auftut ist wunderschön"
Dr Ana-Maria GebingDie FaszinationUnter die Haut sehen
"Es ist faszinierend unter die Haut sehen zu können und die Korrelation nach außen zu erkennen", sagt Dr Ana-Maria Gebing und strahlt dabei.
Ana-Maria Gebing ist vor vielen Jahren als Ärztin nach Deutschland gekommen. Heute hat sie ein eigenes Labor für Dermatopathologie. Der Weg bis dorthin war hart und hat sie eine Ehe gekostet.
In Ellewick
Ana-Maria Gebings Mann Thomas hat Angst um seine Frau. "Fällt sie einmal aus, haben 20 Mitarbeiter ab morgen nichts mehr zu tun", sagt er. Alle technologischen Möglichkeiten, die seine Frau entlasten, sind ihm willkommen. Gerade investiert er mehrere Hunderttausend Euro in eine Multiscananlage.
Wäre es möglich im Vertretungsfall digitale Scans an befreundete Pathologen zu senden, oder in schwerwiegenden Verdachtsfällen auch einmal vom Krankenbett aus zu befunden, könnte die ganze Familie aufatmen.
Thomas Gebing kämpft auf allen Ebenen. "Wird das von der Kassenärztlichen Vereinigung nicht anerkannt, sorge ich dafür, dass Jens Spahn hierher kommt. Die Bundesregierung will die Digitalisierung im Gesundheitswesen, wir machen sie. Er soll dafür sorgen, dass sie auch anerkannt wird."
Die AngstIm Entsendegeschäft geht es um Erreichbarkeit
Pathologie ist ein Entsendegeschäft. Kunden sind die Arztpraxen. Das Labor an das sie ihre Proben entsenden suchen sie sich selbst aus. Könnte 'ihr' Labor keine Proben mehr annehmen, müssten sie ihren Workflow auf die Zusammenarbeit mit einem anderen Labor umstellen. Die Umstellung rückgängig zu machen würde die Ärzte nur Zeit kosten, aber keinen Vorteil bringen.
Also darf es bei den Gebings keinen Ausfall geben.
Berufskrankheit Rücken
Dr. Klaus GriewankDer Hautarzt kann allesLabor und Praxis im ländlichen Raum
.
Nach verschiedenen beruflichen Stationen - unter anderem in der Hautkrebsforschung in New York und San Francisco - hat Klaus Griewank sein ideales Betätigungsfeld gefunden: „Als Hautarzt mit Zusatzausbildung Dermatohistologie kann ich vieles zusammenbringen: ich sehe meine Patienten, kann operieren, histologisch die Diagnose stellen und die geeignete Therapien durchführen.“ Das Gefühl in vielerlei Hinsicht autark zu sein, gefällt ihm ausgesprochen gut.
Noch scheut er die Investition in ein Digitalmikroskop mit der notwendigen Infrastruktur, da ihm immer noch sein Vorgänger als Entlastung zur Seite steht.
ÄngsteFundamentale Veränderung
Zwei Gründe zu digitalisierenKonsiliarbefunde und Vertretungen
Ein digitales Abbild hingegen kann in Sekunden übertragen werden.
Lohnt sich die Investition?
InhaltWeitere Kapitel
Die Digitalisierung
Prodermpath Das Digitalisierungsprojekt bei Dr. Gebing Vorreiter in Ellewick
Prodermpath Das Digitalisierungsprojekt bei Dr. Gebing Vorreiter in Ellewick

Labor am Limit
Das Labor in Ellewick ist bereits mit moderner Technik ausgestattet. Dazu gehört ein IT-System, das ab Probeneingang jeden Arbeitsschritt abbildet: Infos zum Einsender, zum Patienten, zur Probe und dem Befund ebenso wie Infos zu den durchgeführten Antikörpertests. Ein kompletter Raum ist für den Färbeautomat und die künftige Multiscananlage vorgesehen. "Ich beobachte genau, welche Geräte es am Markt gibt", sagt Gebing.
Einsparpotenzial durch Multiscananlage
Gebing suchte intensiv nach weiteren technischen Lösungen. "Wir müssen die Abläufe im Labor so effizient wie möglich gestalten", sagt er. Einen kompletten Arbeitsplatz könnte er einsparen, wenn die Objektträger automatisiert archiviert würden. Das digitale Befunden könnte seine Frau entlasten. "Ich will dass meine Frau ortsunabhängig arbeitet und Patholgen aus entfernten Praxen schnell hinzuziehen kann." Er fand keine Scanner-Anlage, die in der Lage war, das hohe Aufkommen seines Labors über Nacht abzuarbeiten.
Das wird die Pathologie auf den Kopf stellen Proben automatisiert scannen
Das wird die Pathologie auf den Kopf stellen Proben automatisiert scannen

Nach vielen Rückschlägen
Per Roboter scannen
Alle Objektträger, die die LaborantInnen im Laufe eines Tages herstellen, sollten von einem Roboter unter die Digitalmikroskope gelegt und von diesen automatisiert eingescannt werden. Die digitalen Bilder sollten anschließend mit den zugehörigen Patientendaten im Archiv und zum Befunden auf dem PC von Dr. Gebing landen.
Technische und rechtliche Probleme
Eine schwierige Aufgabe: Unter den hohen Beschleunigungskräften des Roboters zerbrachen erst die dünnen Objektträger.
Dann gab es keine zusammenpassende Softwarelösung für alle Aufgaben der Anlage. Und ob die Scans tatsächlich dem Realbild des Gewebes unter dem Mikroskop entsprechen, konnte ihm keiner garantieren. "Ich wußte nicht, dass es keine Validierug für die Digitalmikroskope gibt", ärgert sich Gebing. Der Mikroskophersteller Precipoint war ratlos: "Wir haben unsere Mikroskope immer so wie sie sind in die Pathologie verkauft", meinte der Geschäftsführer. In wessen Verantwortungsbereich liegt es, die Qualität der Scans zu beurteilen? Noch gibt es dazu keine gesetzliche Regelung. Gebing und der Geschäftsführer von Precipoint konnten sich auf eine Validierung der Geräte einigen.
Dann dauerte es Gebing zu lange, eine Archivierungssoftware schreiben zu lassen. "Was habe ich davon, wenn die Anlage hier herumsteht wie ein toter Hund?" Unruhig kontrolliert er die verschiedenen Rahmen, die sich auf dem Monoitor seiner Anlage abzeichnen. Irgendetwas stimmt nicht und er greift zum Telefon, um den Programmierer bei Precipoint anzurufen. Die Scanner müssen erkennen, wo der Zuschnitt des Gewebes aufhört. Doch die sind unregelmäßig und ragen manchmal bis weit an den Rand. "Wenn nur eine Zelle übersehen wird und das eine Krebszelle ist..." Die Folgen möchte sich Thomas Gebing gar nicht ausmalen.
Doch Schritt für Schritt können die Geschäftspartner ein Problem nach dem anderen lösen und die Anlage beginnt zu laufen.
Die Multiscananlage läuftAlle Schritte vom Befüllen bis ins Archiv
Softwareschnittstelle QR-Code
Ein wichtiger Schritt, denn über den Code auf dem Objektträger wird das Gewebe eindeutig einem Patienten zugeordnet.
Weder Code noch Datenbank entsprechen einem Standard. Jeder Hersteller programmiert sein eigenes System und so kann ein anderer Pathologe die gläsernen Objektträger nicht in sein System übernehmen. Das erschwert den Austausch untereinander.
DigitalmikroskopDas digitale Abbild entsteht
Wesentlich ist eine intelligente Software, die erkennen kann, welche Bereiche auf dem Objektträger zum Gewebe gehören, welche nicht.
Archivierung
Der wird am nächsten Morgen aus der Anlage genommen und so wie er ist, in das Archiv des Labors geräumt. Die Archivkästen müssen 10 Jahre lang aufbewahrt werden.
Auch wenn ein digitales Archiv platzsparender wäre und die Bildqualität über die 10 Jahre unverändert bliebe - im Gegensatz zur realen Probe - ist das Aufbewahren der Glasträger gesetzlich vorgeschrieben.
Digitalisierung
Die Digitalisierung bietet außerdem für einfache Laborarbeiten, wie das Archivieren Rationalisierungspotenzial.
Doch hohe Invests, fehlende Standards und große Unsicherheit der Branche gegenüber der Technologie und der rechtlichen Lage bremsen ihren Einzug in Pathologie-Praxen.
Vor dem Schritt in die DigitalisierungEs führt kein Weg daran vorbei
Ana-Maria Gebing und Klaus Griewank sind sich mit Gunter Haroske einig, dass ihnen die digitalen Technologien im Alltag helfen würden.
Noch geht es darum, die Voraussetzungen zu schaffen, die Digitalisierung umfassend zu nutzen. Ist dies geschehen, wird sich zeigen, wie groß der Bestandteil ihrer Arbeit ist, den intelligente Systeme übernehmen können.
Ähnlich wie beim autonomen Fahren sind die Systeme mittel- bis langfristig sicher nicht in der Lage, den Menschen zu ersetzen.
Intelligente BildverarbeitungTumorwachstum bestimmenBeispiel Ki67-Algorithmus

Dazu muss er allerdings erst die exakte Anzahl der positiven und negativen Zellen bestimmen. Versucht man die Zellen auf dem linken Bild zu zählen, wie es die Mehrheit der Pathologen bis heute tut, zeigt sich schnell, wie groß der Aufwand ist.
Mit einem mathematischen Algorithmus geht das per Knopfdruck. Der Ki67-Algorithmus ist ein Beispiel für eine erprobte Funktion intelligenter Bildverarbeitung, die die Arbeit des Pathologen vereinfacht. "Der Pathologe erhält eine exakte Auskunft zum Verhältnis der Zellen, die sich gerade in Teilung befinden zu den übrigen Zellen", sagt Dr. Stephan Wienert, Software-Entwickler bei PreciPoint. Sein Algorithmus färbt die Ki67-positiven Zellen rot und die Ki67-negativen Zellen grün (siehe rechtes Bild) und kann so in Sekunden die Tumorproliferation angeben.
Raus aus der BlackboxKI geht einen Schritt weiter
Erschwerend kommt hinzu, dass die Präparate jeweils die Handschrift ihres Labors tragen und in Schnitt und Färbung stark voneinander abweichen. „Die Heterogenität der Labore ist das eine, hinzukommt, dass menschliches Gewebe, sowohl gesundes als auch krankes ebenfalls eine enorme Varianz aufweist.“, sagt der KI-Experte Stephan Wienert. Umso mehr Muster wären als Basis für die KI nötig, doch die müssten erst einmal von den Laboren geliefert werden. „Ein weiterer Kritikpunkt an KI-Systemen ist, dass der Mensch wissen will, auf welchen Parametern der Tumorscore beruht“, so Wienert. Denn ein KI-System gibt meist nur einen Wert zur Tumorwahrscheinlichkeit aus, aber kann nicht erklären, wie es zu diesem Wert kommt.
An der Lösung dieses Problems arbeitet u.a. eine Gruppe von KI-Wissenschaftler und Pathologen des Berliner Unternehmen AIgnostics. Die Software von AIgnostics erzeugt s.g. Heatmaps, die den Anteil einzelner Pixel am Gesamtergebnis darstellen. Damit lässt sich sehr einfach und schnell überprüfen ob der Algorithmus die richtigen „Stellen“ im Gewebe erkannt hat und das Ergebnis plausibel ist.
Im Bild ein Screenshot von AIgnostics mit Tumorscore und Anzahl der Lymphozyten, Tumorzellen.
Einschätzungen von Griewank, Hiroske und Gebing
Im Labor
PROdermpath in EllewickBritta Brockmann erklärt die Arbeit im digitalen LaborZu Besuch an der holländischen Grenze
Bis vor Eröffnung des Labors lebte sie in Argentinien. Dort forschte sie in der Mikrobiologie. Der Großstadt kehrte sie gerne den Rücken, um wieder in der ländlichen Heimat sein zu können. Sie beherrscht jeden Schritt eines 'Laufes':
Der LaufVom Präperat zum Scan
Mehrmals am Tag holen die Fahrer Gewebeproben aus den Praxen im Umkreis von 100 km.
Patientendaten und klinische Informationen werden in das Informationssystem des Labors eingegeben, eine Labornummer und ein Strichcode-Aufkleber erstellt und auf Gefäß und Begleitformulare geklebt.
VorbereitungZuschnitte erstellenDas Gewebe wird zerteilt und vermessen
Entwässern und einbettenVorbereitung für den Feinschnitt
Im Labor von Dr. Gebing arbeiten zehn Laboranten/innen. Das sind zu wenig Kräfte. Im ländlichen Raum geeignete Mitarbeiter zu finden ist nicht einfach. "Die Mitarbeiter müssen Vorkentnisse mitbringen", sagt Brockmann. Man sei noch in der Teamfindungsphase.
Auf Eis gelegtAuf Eis kühlt das flüssige Paraffin aus
Brita Brockmann ist als Leiterin des Labors nicht nur für das Team verantwortlich. In ihrem Labor stehen einige Hightechmaschinen, die der technische Leiter Thomas Gebing angeschafft hat.
"Ich habe keine Angst von Automaten ersetzt zu werden. Wir haben soviel Arbeit", sagt Brockman. Automaten wie die Multiscananlage oder der Färbeautomat nehmen ihrem Team Routinetätigkeiten ab.
Das Mikrotom
Da das eingebettete menschliche Gewebe nicht gleichmäßig in dem Paraffin-Block verteilt ist, muss die Laborantin einen großen Teil des hauchdünnen Materials aussortieren und nur die Gewebestreifen ins Wasserbad legen.
Im Wasserbad
FärbenEosin, Hematoxylin, Periodsäure,
Wie lange Eosin, Hematoxylin, Periodsäure oder andere Ingredenzien dazu brauchen und welche verwendet werden entscheidet Frau Dr. Gebing.
ScannenAus dem Färbeautomaten in den Scanner
Die kleinen Körbchen sind schnell eingefüllt und sie geht zurück. "Für uns hat die Digitalisierung auch Vorteile: das lästige Sortieren der Objektträger fällt weg."
MultiscananlageWSI und Archivieren
Noch gibt es wenige dieser Anlagen auf dem Markt.
Die Objektträger werden von einer Digitalkamera aufgenommen und die Bilder in einer Datenbank des Laborsystems abgelegt. Die Glasträger werden anschließend in einen Archivbehälter einsortiert und ein digitales Register angelegt.
Befunden
Berufsbild
Status QuoBerufsbild Facharzt für PathologieTod und Leben
Doch eigentlich untersucht der Pathologe - im Gegensatz zum Gerichtsmediziner - Zellen und Gewebe von lebenden Menschen. An Hand der präparierten Proben charakterisiert und differenziert er Tumore und Krankheiten. Sogar das biologische Verhalten eines Tumors in der Zukunft und das Ansprechen des Patienten auf die Therapie kann er aus dem Erscheinungsbild der Zellen herauslesen.
Die Weiterbildung zum Pathologen erfolgt nach dem Medizinstudium und dauert sechs Jahre. Insgesamt muss der künftige Pathologe also erst einmal 12 Jahre lernen.
Doch wie auch Dr. Gebing und Dr. Griewank entscheiden sich manche erst nach der Facharztausbildung zu einer Zusatzausbildung zum Haut-Pathologen, die dauert zwei Jahre, womit sie also auf eine Ausbildungsdauer von 14 Jahren kommen.

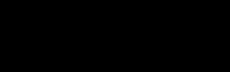






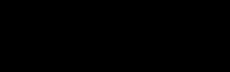



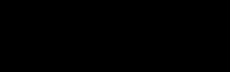



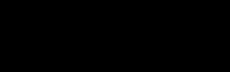
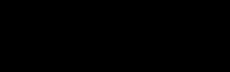









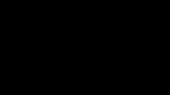






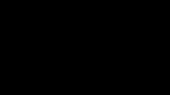



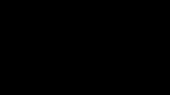



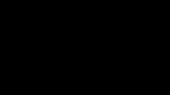
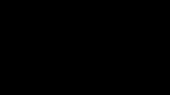





















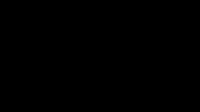 Pathologe vom Aussterben bedroht
Pathologe vom Aussterben bedroht
 Krebsdiagnose per Maschine
Krebsdiagnose per Maschine
 KI wird kommen
KI wird kommen
 Inhalt
Inhalt
 Fakten & Zahlen zur Branche
Fakten & Zahlen zur Branche
 ... denn ohne pathologischen Befund, keine Krebstherapie
... denn ohne pathologischen Befund, keine Krebstherapie
 Digitalisierung ist notwendig
Digitalisierung ist notwendig
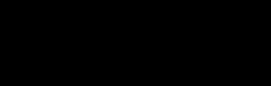 Inhalt
Inhalt
 Ein sehr spezieller Berufsalltag
Ein sehr spezieller Berufsalltag
 Die Faszination
Die Faszination
 In Ellewick
In Ellewick
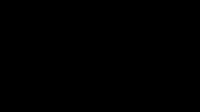 Die Angst
Die Angst
 Berufskrankheit Rücken
Berufskrankheit Rücken
 Der Hautarzt kann alles
Der Hautarzt kann alles
 Fundamentale Veränderung
Fundamentale Veränderung
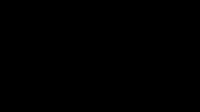 Zwei Gründe zu digitalisieren
Zwei Gründe zu digitalisieren
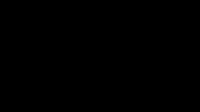 Lohnt sich die Investition?
Lohnt sich die Investition?
 Das wird die Pathologie auf den Kopf stellen
Das wird die Pathologie auf den Kopf stellen
 Die Multiscananlage läuft
Die Multiscananlage läuft
 QR-Code
QR-Code
 Digitalmikroskop
Digitalmikroskop
 Archivierung
Archivierung
 Digitalisierung
Digitalisierung
 Es führt kein Weg daran vorbei
Es führt kein Weg daran vorbei
 Tumorwachstum bestimmen
Tumorwachstum bestimmen
 KI geht einen Schritt weiter
KI geht einen Schritt weiter
 Britta Brockmann erklärt die Arbeit im digitalen Labor
Britta Brockmann erklärt die Arbeit im digitalen Labor
 Vom Präperat zum Scan
Vom Präperat zum Scan
 Zuschnitte erstellen
Zuschnitte erstellen
 Entwässern und einbetten
Entwässern und einbetten
 Auf Eis gelegt
Auf Eis gelegt
 Das Mikrotom
Das Mikrotom
 Im Wasserbad
Im Wasserbad
 Färben
Färben
 Scannen
Scannen
 WSI und Archivieren
WSI und Archivieren
 Befunden
Befunden
 Berufsbild Facharzt für Pathologie
Berufsbild Facharzt für Pathologie